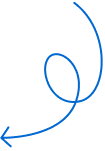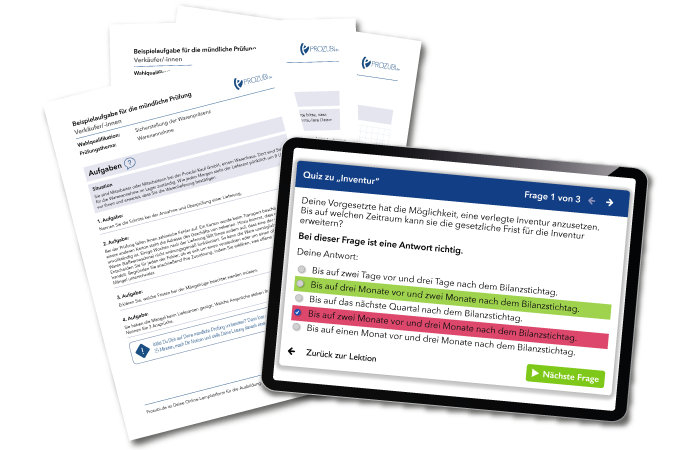















| PRÜFUNGSTEIL | PRÜFUNGSPHASE | DATUM |
| Abschlussprüfung Teil 1 | Frühjahr 2026 | 25.02.2026 |
| Abschlussprüfung Teil 2 | Sommer 2026 | 29.04.2026 |
| Mündliche Abschlussprüfung | Sommer 2026 | Juni / Juli 2026 |
| Abschlussprüfung Teil 1 | Herbst 2026 | 30.09.2026 |
| Abschlussprüfung Teil 2 | Winter 2026/27 | 25.11.2026 |
| Mündliche Abschlussprüfung | Winter 2026/27 | Januar 2027 |
| Abschlussprüfung Teil 1 | Frühjahr 2027 | 24.02.2027 |
| Abschlussprüfung Teil 2 | Sommer 2027 | 28.04.2027 |
| Mündliche Abschlussprüfung | Sommer 2027 | Juni / Juli 2027 |
Die Abschlussprüfung für Industriekaufleute ist aufgeteilt in zwei Teile. Man nennt sie deshalb auch „gestreckte Abschlussprüfung“.
Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung findet normalerweise zum Ende des zweiten Ausbildungsjahres statt. Dort kommt der Prüfungsbereich Organisieren des Warensortiments und von Dienstleistungen dran. Die Prüfung findet schriftlich statt.
Teil 2 der gestreckten Abschlussprüfung findet am Ende der Ausbildung statt. Hier gibt es insgesamt vier Prüfungsbereiche. In drei davon finden die Prüfungen schriftlich statt. Welche Prüfungsbereiche Du genau hast, hängt davon ab, ob Du Deine Ausbildung in der Fachrichtung Großhandel oder Außenhandel machst.
Wenn Du im Großhandel bist, heißen die drei schriftlichen Prüfungsbereiche:
Und wenn Du im Außenhandel bist, sind das die drei schriftlichen Prüfungsbereiche:
Zu Teil 2 der Abschlussprüfung gehört aber auch noch die mündliche Prüfung. In der Fachrichtung Großhandel heißt der Prüfungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen Fachaufgabe im Großhandel - und in der Fachrichtung Außenhandel entsprechend Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen Fachaufgabe im Außenhandel. Die mündliche Prüfung findet einige Wochen nach der schriftlichen Prüfung statt. Den genauen Termin erfährst Du rechtzeitig von Deiner IHK. Mit dem Bestehen der mündlichen Prüfung ist Deine Ausbildung dann beendet.
| PRÜFUNGSTEIL | PRÜFUNGSBEREICH | BEARBEITUNGSZEIT | GEWICHTUNG |
| Teil 1 | Organisieren des Warensortiments und von Dienstleistungen | 90 Minuten | 25 % |
| Teil 2 | Kaufmännische Steuerung von Geschäftsprozessen | 60 Minuten | 15 % |
| Teil 2 | Prozessorientierte Organisation von Großhandelsgeschäften / Außenhandelsgeschäften | 120 Minuten | 30 % |
| Teil 2 | Wirtschafts- und Sozialkunde | 60 Minuten | 10 % |
| Teil 2 | Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen Fachaufgabe im Großhandel / Außenhandel | 30 Minuten | 20 % |
Starte jetzt mit Prozubi, um Dich perfekt auf Deine Abschlussprüfung vorzubereiten. In unseren Lernvideos zeigen wir Dir die Themen Deiner Ausbildung. Mit den Übungsaufgaben nach jedem Video kannst Du überprüfen, ob Du alles verstanden hast. Erfahrene Ausbildungsexperten helfen Dir in unserem Expertenchat in Sekundenschnelle weiter, wenn Du mal eine Frage hast. Und mit der Prozubi-Prüfungssimulation kannst Du dann noch wie unter echten Prüfungsbedingungen üben und schauen, wie gut Du wirklich auf die Prüfung vorbereitet bist.
Für Dich prüfen wir laufend die neuesten IHK-Abschlussprüfungen und erstellen alle unsere Lerninhalte streng nach den Vorgaben des IHK-Prüfungskatalogs.
Und wir sind nicht nur für die Prüfungsvorbereitung geeignet, mit uns kannst Du Dich auch auf den Unterricht und Klausuren in der Berufsschule vorbereiten. Ganz egal, ob Du zu Hause mit dem Laptop oder unterwegs mit dem Smartphone lernen möchtest. Mit Prozubi hast Du Deine Lerninhalte immer dabei! Im Web und in der Prozubi-App.
| Lernfeld 1 | Im Lernfeld „Das Unternehmen präsentieren und die eigene Rolle mitgestalten“ lernst Du, was es mit dem dualen System auf sich hat und welche Aufgaben, Rechte und Pflichten die daran Beteiligten haben. Außerdem erfährst Du, welche Rechte und Pflichten sich aus Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen ergeben und welche rechtlichen Regelungen Du hier und beim dualen System beachten musst. Du lernst die Formen und Funktionen des Groß- und Außenhandels kennen, erfährst, was ein Leitbild ist, welche Unternehmensziele verfolgt werden, welche Rechtsformen es gibt und wie die Ablauf- und Aufbauorganisationen Deines Unternehmens aussehen. Zudem wird Dir vermittelt, wie Deine Entgeltabrechnung aufgebaut ist, was technologischer Wandel und kurze Innovationszyklen bedeuten und wie Du diese Aspekte sinnvoll in die Unternehmensplanung einbeziehst. Du erfährst auch, wie Du bei einer Präsentation den Anlass berücksichtigst und die passenden Medien und Techniken auswählst, welche Kommunikationstechniken es gibt und wie Du Feedback gibst und empfängst. |
| Lernfeld 2 | Im Lernfeld „Aufträge kundenorientiert bearbeiten“ lernst Du, welche rechtlichen Vorschriften Du bei der Erstellung und dem Abschluss von Kaufverträgen beachten musst. Du bearbeitest Anfragen, erstellst Angebote, Lieferscheine und Rechnungen für Kundinnen und Kunden, lernst, was eine Bonitätsprüfung ist und wann sie sinnvoll ist. Du setzt Dich mit verschiedenen Kommunikationswegen auseinander – insbesondere im Hinblick auf die Kommunikation mit Geschäftskundinnen und -kunden – sowie mit Gesprächsführungs- und Verhandlungstechniken und Möglichkeiten zum Umgang mit Einwänden. Außerdem erfährst Du, was Stammdatenmanagement bedeutet und wie es strukturiert ist, wie Du Datensicherheit und Datenschutz in Deinem Unternehmen gewährleistest, warum es wichtig ist, Serviceleistungen, Zusatzartikel und Finanzierungsangebote zu unterbreiten und wie Du langfristig Kundenzufriedenheit und -bindung verbessern kannst. |
| Lernfeld 3 | Im Lernfeld „Beschaffungsprozesse durchführen“ erfährst Du, was das Sortiment ist und welchen Einfluss Nachfrage, Konkurrenz sowie aktuelle und zukünftige Marktentwicklungen nicht nur auf das Sortiment, sondern auch auf das gesamte Unternehmen haben. Du lernst den vollständigen Beschaffungsprozess kennen – von der Bedarfsermittlung über die optimale Bestellmenge und den besten Bestellzeitpunkt bis hin zur Bezugsquellenermittlung, dem Angebotsvergleich und der Bezugspreiskalkulation. Dabei wird auch vermittelt, worauf Du bei der Beschaffung aus EU-Staaten und Drittländern achten musst. Zusätzlich erfährst Du, was Incoterms sind, wie Du Währungen umrechnest und wie Du Lieferanten sinnvoll bewertest. |
| Lernfeld 4 | Im Lernfeld „Werteströme erfassen und dokumentieren“ lernst Du, was unter Werteströmen und Finanzbuchhaltung zu verstehen ist und welchen Einfluss diese auf Vermögen, Kapital und Erfolg des Unternehmens haben. Du setzt Dich mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung auseinander, erfährst, welche rechtlichen und betrieblichen Regelungen bei der Belegbearbeitung gelten und lernst Begriffe wie Kontenrahmen, Erfolgskonten und Bestandskonten kennen. Zudem erfährst Du, welche Arten von Buchungen es gibt, wie sie durchgeführt werden, wie Du die Werte der Finanzbuchhaltung mit Bestandswerten vergleichst und bei Differenzen geeignete Maßnahmen ergreifst. Auch die Informations- und Dokumentationsfunktion der Buchhaltung wird thematisiert. |
| Lernfeld 5 | Im Lernfeld „Kaufverträge erfüllen“ lernst Du, welche Rechte und Pflichten sich aus Verpflichtungs- und Erfüllungsgeschäften ergeben und welche Besonderheiten bei Verträgen zwischen Lieferanten und Geschäftskundkunden bestehen. Du erfährst, welche Störungen im Kaufvertrag auftreten können und welche rechtlichen Konsequenzen sich daraus ergeben. Dabei werden auch mangelhafte Leistungen, Liefer- und Zahlungsverzug sowie ein effektives Retouren- und Reklamationsmanagement behandelt. Zudem lernst Du, wie Du Ein- und Ausgangsrechnungen kontrollierst, Zahlungen veranlasst und Zahlungseingänge überwachst. Du setzt Dich auch mit dem Thema Risikoabsicherung auseinander und erfährst, warum sie für Dein Unternehmen wichtig ist. |
| Lernfeld 6 | Im Lernfeld „Ein Marketingkonzept entwickeln“ erfährst Du, wie Du mithilfe der Marktforschung die aktuelle Marktsituation analysierst und daraus fundierte Marketingziele ableitest. Du entwickelst einen passenden Marketing-Mix und beziehst dabei die unterschiedlichen Marketinginstrumente mit ein. Zudem lernst Du die rechtlichen Rahmenbedingungen des Wettbewerbs sowie verschiedene Preisstrategien und deren betriebsinterne und -externe Einflussfaktoren kennen. |
| Lernfeld 7 | Im Lernfeld „Außenhandelsgeschäfte anbahnen“ erfährst Du, welche Risiken und Möglichkeiten der Risikoabsicherung sowie interkulturellen Rahmenbedingungen bei Auslandsgeschäften zu beachten sind. Du lernst, worauf es beim Warenhandel mit EU-Staaten und Drittländern ankommt – dazu gehören unter anderem erforderliche Dokumente, Zollanmeldungen und Einfuhrabgaben für See- und Landverkehr. Auch internationale Rechtsnormen und Incoterms werden Dir vermittelt. |
| Lernfeld 8 | Im Lernfeld „Werteströme auswerten“ lernst Du die rechtlichen Vorgaben zum Jahresabschluss, zur Bilanz und Erfolgsrechnung sowie Bewertungsprinzipien für Vermögens- und Schuldenwerte kennen. Du erfährst, wie Abschreibungen, Rückstellungen und der Grad der Zielerreichung im Unternehmen berechnet und analysiert werden. Zusätzlich lernst Du Kennziffern zur Bewertung von Vermögens- und Kapitalstruktur, Erfolg und Finanzlage kennen sowie den Umgang mit Statistiken, grafischen Darstellungen, Leasing und Factoring. |
| Lernfeld 9 | Im Lernfeld „Geschäftsprozesse mit digitalen Werkzeugen unterstützen“ erfährst Du, welche Funktionen E-Business-Systeme haben und wie entscheidend die Datenqualität für deren Funktionsfähigkeit ist. Du setzt Dich mit Datenschutz und Datensicherheit bei der Verarbeitung von Kundinnen- und Kundendaten sowie Unternehmensdaten auseinander. Du lernst außerdem, worauf bei der Gestaltung der Unternehmenswebseite und beim Einsatz von Kundenmanagementsystemen geachtet werden sollte und welche digitalen Vertriebskanäle sinnvoll sind. Zudem erfährst Du, was Bulk-Bearbeitung und ABC-Analyse bedeuten, welche Datenformate geeignet sind, welche Risiken durch digitale Geschäftsprozesse entstehen und wie Du Deine Sicherheitsmaßnahmen optimierst. |
| Lernfeld 10 | Im Lernfeld „Kosten- und Leistungsrechnung durchführen“ erfährst Du, wie sich Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger und Leistungen voneinander unterscheiden und was kalkulatorische Kosten sind. Du lernst die Durchführung der Vollkostenrechnung, die Abgrenzung von Kosten und Leistungen gegenüber Aufwendungen und Erträgen sowie das Ausfüllen eines einstufigen Betriebsabrechnungsbogens. Zudem berechnest Du Gemeinkostenzuschlagssätze, wendest verschiedene Kalkulationsarten an und nutzt die Teilkostenrechnung, um den Erfolg einzelner Warengruppen zu analysieren und daraus Maßnahmen abzuleiten. Auch das Controlling als Steuerungs- und Informationsinstrument wird Dir nähergebracht. |
| Lernfeld 11 | Im Lernfeld „Waren lagern“ erfährst Du, welche Lagerbereiche und -abläufe es gibt, zwischen welchen Lagerarten und -systemen Du wählen kannst und wie Du eine warengerechte Lagerung unter Berücksichtigung von Arbeitsschutzvorschriften organisierst. Du lernst, wie Du bei Terminüberwachung, Warenannahme und Wareneingang vorgehst, wie Du Störungen behebst und Retouren an Lieferanten bearbeitest. Zudem setzt Du Dich mit Kommissionierverfahren und Inventurarten auseinander und lernst, welche Ursachen Inventurdifferenzen haben können und wie Du darauf reagierst. Du berechnest Lagerbestände, Lagerkennziffern und Lagerhaltungskosten und entscheidest basierend darauf zwischen Eigen- und Fremdlagerung. Auch die Vorbereitung und der Abschluss von Lagerverträgen werden behandelt. |
| Lernfeld 12 | Im Lernfeld „Warentransporte abwickeln“ lernst Du verschiedene Verkehrsmittel, -wege und -träger kennen. Du erfährst, welche Versandarten es gibt, wie Du Versandkosten berechnest und welche Rechte und Pflichten die am Versand beteiligten Parteien haben. Du lernst, wie Du zwischen Werkverkehr und externem Versand (z. B. durch Frachtführer oder Speditionen) entscheidest und eine Tourenplanung erstellst. Auch die Vorbereitung von Versandpapieren, Verpackung von Waren sowie die Organisation von Sendungsverfolgung und Terminüberwachung werden vermittelt. |
| Lernfeld 13 | Im Lernfeld „Ein Projekt im Großhandel planen und durchführen“ lernst Du alle relevanten Schritte des Projektmanagements kennen – von der Idee über die Planung bis zur Präsentation der Ergebnisse. Du erfährst, welche Phasen des Projektmanagements es gibt, wie Projektstrukturpläne und Projektphasenmodelle aufgebaut sind und wie Du Projektziele SMART formulierst. Zudem lernst Du Kreativitätstechniken, Gesprächsregeln für erfolgreiche Teamarbeit sowie das Verfassen von Protokollen. |
| Lernfeld 11 | Im Lernfeld „Internationale Warentransporte abwickeln“ lernst Du die rechtlichen Grundlagen des internationalen Warenverkehrs kennen. Du erfährst, welche Verkehrsträger für Dein Unternehmen geeignet sind und welche Besonderheiten der Containertransport mit sich bringt. Du bereitest erforderliche Dokumente vor, beachtest Schritte der Transportabwicklung und berechnest Einfuhrabgaben. Zudem lernst Du, wie Du Transportanfragen erstellst, Frachtangebote vergleichst, eine Transportversicherung auswählst und im Schadensfall agierst. Auch die Kommunikation mit Transportdienstleistern, Kundinnen und Kunden sowie Lieferanten – ggf. in einer Fremdsprache – wird behandelt. |
| Lernfeld 12 | Im Lernfeld „Außenhandelsgeschäfte abwickeln und finanzieren“ lernst Du, wie Du Finanzierungskosten und Rücklaufzeiten berechnest und eine Angebots-, Export- und Importkalkulation durchführst. Du erfährst, was Währungsmanagement bedeutet und wie Garantien zur Risikoabsicherung eingesetzt werden. Zudem erstellst, prüfst und übermittelst Du internationale Handelsdokumente, kontrollierst Zahlungsströme und setzt Dich mit Liquiditätsstatus, -planung und kurzfristigen Finanzierungsmöglichkeiten wie dem Kontokorrentkredit auseinander. |
| Lernfeld 13 | Im Lernfeld „Ein Projekt im Außenhandel planen und durchführen“ lernst Du alle Phasen eines Projekts kennen – von der Idee über Planung und Durchführung bis zur Präsentation. Du arbeitest mit Projektstrukturplänen, formulierst SMART-Ziele und nutzt Projekt-Scorecards. Zudem setzt Du Kreativitätstechniken ein, beachtest Gesprächsregeln und erstellst Protokolle zur Dokumentation des Projektfortschritts. |
Sortimentspolitik
Sortimentsaufbau und Sortimentspyramide
Sortimentsstruktur: Sortimentsbreite und Sortimentstiefe
Sortimentsstruktur: Kern-, Rand- und Saisonsortiment
Markenartikel, Herstellermarken und Handelsmarken
Kontrolle des Warenangebots
Sortimentsbereinigung
Sortimentserweiterung und Diversifikation
Ergänzungsartikel und Zusatzartikel
Renner-Penner-Listen
Dienstleistungen von Unternehmen
Serviceleistungen
Leasingvertrag
Skonto: Überblick
Bedarfsermittlung
Bedarfsermittlung und Bedarfsmeldung
Absatz- und Umsatzstatistik
Marktforschung
Konkurrenzbeobachtung
Bedarfsermittlung: ABC-Analyse
Bedarfsermittlung: ABC-Analyse (Beispiel)
Warenwirtschaftssystem
Ziele der Warenwirtschaft
Aufgaben der Warenwirtschaft
Was ist das Warenwirtschaftssystem?
Aufgaben des Warenwirtschaftssystems
Ziele des Warenwirtschaftssystems
Erfassung von Daten im Warenwirtschaftssystem
Fehler bei der Erfassung von Daten
Änderung von Daten im Warenwirtschaftssystem
Verpackungen
Verpackungsvorschriften
Bestandteile einer Verpackung
Funktionen von Verpackungen
Arten von Verpackungen
Beanspruchungen der Verpackung
Einweg- und Mehrwegpackmittel im Vergleich
Packmittel aus Papier, Pappe und Karton
Verpackungsgesetz
Waren- und dienstleistungsbezogene Normen und Regeln
Geschäftsbriefe (u.a. DIN5008, HGB §37a, §125a)
Warenkennzeichnung: Bedeutung
Warenkennzeichnung: Güte-, Marken-, Umwelt- & Prüfzeichen
Bezugsquellen ermitteln und Angebote einholen
Warenbeschaffung, Warenbereitstellung und Warenabsatz
Bezugsquellen
Möglichkeiten für die Bezugsquellenermittlung
Anfrage
Bestellzeitpunkt und Bestellmenge
Bestellung von Waren
Bestellmenge Teil 1
Bestellmenge Teil 2
Bestellzeitpunkt
Just-in-Time-Methode - Produktionssynchrone Beschaffung
Angebote vergleichen und bewerten
Angebot
Angebotsvergleich
Finanzierungserfolg durch Skontoausnutzung
Skonto: Überblick
Skonto: Lohnt sich ein Kontokorrentkredit?
Skonto: Effektiver Jahreszinssatz
Waren bestellen und Dienstleistungen beauftragen
Bestellung und Terminüberwachung
Bestellung
Beschaffungsrisiko
Verträge abschließen
Vertragsfreiheit
Merkmale von Kaufverträgen 1
Merkmale von Kaufverträgen 2
Inhalt eines Kaufvertrages
Lieferbedingungen und Incoterms 1
Lieferbedingungen und Incoterms 2
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zustandekommen eines Kaufvertrages
Verpflichtungsgeschäft und Erfüllungsgeschäft
Eigentumsvorbehalt
Anfragen bearbeiten
Anfrage
Arten und Funktionen von Produktdaten
Grundlagen des Datenschutzes
Datenschutz bei Kundendaten
Datensicherheit
Auftragsbearbeitung und Rechnungserstellung
Angebot erstellen
Die Rechnung
Kommunikation mit Kunden
Überblick Kommunikation mit Kunden
Verbale Kommunikation
Nonverbale Kommunikation
Kommunikation mit schwierigen Kunden
Kommunikationsmodelle (Sender-Empfänger-Modell und Vier-Ohren-Modell)
Beruflich Telefonieren
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von (telefonischen) Gesprächen
Beratungs- und Verkaufsgespräche
Anforderungen des Kunden an das Verkaufspersonal
Phasen des Verkaufsgespräches
Gesprächstechniken für das Verkaufsgespräch
Fragetechniken zur Bedarfsermittlung
Kaufmotive
Kundentypen
Grundsätze der Warenvorlage
Verkaufsargumente
Preisnennung mit der Sandwich-Methode
Verhalten bei Kundeneinwänden
Ergänzungsartikel und Zusatzartikel
Abschluss des Verkaufsgespräches
Grundlagen der Kalkulation
Das Kalkulationsschema
Welche Begriffe sind in der Kalkulation wichtig? Teil 1
Welche Begriffe sind in der Kalkulation wichtig? Teil 2
Rechnen mit vermehrtem Grundwert in Kalkulationen
Richtiges Runden in Kalkulationsaufgaben
Die Vorwärtskalkulation
Vorwärtskalkulation: Überblick
Vorwärtskalkulation: Die Bezugskalkulation
Vorwärtskalkulation: Die Verkaufskalkulation
Prüfungsaufgabe: Bezugskalkulation
Arbeitsplanung und -durchführung
Geschäftsbriefe (u.a. DIN5008, HGB §37a, §125a)
DIN 5008 bei Tabellen
Arbeitsprozesse
Ablauforganisation
Arbeitsabläufe verbessern
Lern- und Arbeitstechniken
Effektives Zeitmanagement
Selbstmanagement
Bedeutung von Terminen
Teamarbeit
Voraussetzungen erfolgreicher Teamarbeit
Vor- und Nachteile von Teamarbeit
Regeln für die Teamarbeit
Planung und Vorbereitung von Teamsitzungen
Konflikte
Konflikte und Konfliktursachen
Konfliktlösung
Konfliktgespräch
Konfliktvermeidung
Präsentation
Was ist eine Präsentation?
Vorbereitung einer Präsentation
Präsentationstechniken
Präsentationsmedien
Gestaltung einer Präsentation
Durchführung einer Präsentation
Bewertung einer Präsentation
Projektarbeit
Merkmale eines Projekts
Projektphasen
Projekt: Zielformulierung (SMART)
Projektstrukturplan / Projektablaufplan (Gantt-Diagramm) und Vorgangsliste
Projektideen: Brainstorming und Mind-Mapping
Projekterfolg (Magisches Dreieck)
Projektbewertung (Projekt-Scorecard)
Projektabschluss
Feedback
Grundlagen Feedback
Feedbackregeln für den Feedbackgeber
Feedbackregeln für den Feedbacknehmer
Inventur
Grundlagen der Inventur
Inventurverfahren
Vorbereitung einer Inventur
Durchführung einer Inventur
Inventurdifferenzen
Berechnung von Inventurdifferenzen
Inventar
Das Inventar I: Anlage- und Umlaufvermögen
Das Inventar II: Schulden und Eigenkapital
Vom Inventar zur Bilanz
Buchführung, Bücher und Belege
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)
Geschäftsvorfälle
Geschäftsvorfälle buchen: Grund- und Hauptbuch
Nebenbücher
Belegarten
Vorbereitung, Buchung und Ablage von Belegen
Aufbewahrungsfristen
Kontenrahmen und Kontenplan
Gliederung des Kontenrahmens
Der Kontenrahmen bei Prozubi
Kontenplan des betrachteten Betriebs
Buchungssätze und Konten
Warm-up: Grundlagen der Buchführung
Bilden von Buchungssätzen I: Der einfache Buchungssatz
Bilden von Buchungssätzen II: Der zusammengesetzte Buchungssatz
Beispiele von Eröffnungsbuchungen
Grundlagen der Buchführung: Häufig benutzte Konten
Buchen auf T-Konten
Buchen auf T-Konten I: Grundlagen
Buchen auf T-Konten II: Das Prinzip der doppelten Buchführung
Buchen auf T-Konten III: Eröffnungs- und Schlussbilanzkonto
Bestands- und Erfolgskonten
Kontenhierarchie
Bestandskonten I
Bestandskonten II
Erfolgskonten I
Erfolgskonten II
Buchen auf Warenkonten
Buchen auf Warenkonten 1: Wareneinkauf
Buchen auf Warenkonten 2: Warenverkauf
Buchen auf Warenkonten 3: Kontenabschluss
Zahlungsvorgänge bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen
Zahlungsarten bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen
Zahlungsvorgänge bei Eingangsrechnungen
Zahlungsvorgänge bei Ausgangsrechnungen
Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast
Systematik der Umsatzsteuer
Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast
Buchungen im Personalbereich
Buchung von Personalkosten
Vermögenswirksame Leistungen
Buchung von vermögenswirksamen Leistungen
Lohnvorschuss
Praxisübung: Gehaltsabrechnung I
Praxisübung: Gehaltsabrechnung II
Buchen von Bestands- und Erfolgsvorgängen
Einkauf von Material und Handelswaren
Verkauf von eigenen Erzeugnissen und Handelswaren
Geleistete Anzahlungen
Erhaltene Anzahlungen
Buchen von Miete und Leasing
Buchung von Kreditgeschäften
Buchung von Rücksendungen und Nachlässen (Verkauf)
Private Vorgänge (Einlagen und Entnahmen)
Bestandsveränderungen
Forderungsausfälle
Anlage- und Wirtschaftsgüter in der Buchhaltung
Verkauf gebrauchter Anlagen mit Gewinn
Verkauf gebrauchter Anlagen mit Verlust
Inzahlunggabe gebrauchter Anlagen
Abschreibung von Anlagegütern - Was ist das?
Abschreibung von Anlagegütern - Wie geht das?
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Bilanz
Wareneinsatz (ermitteln)
Warenrohgewinn (ermitteln)
Bilanz - Bedeutung und Aufbau
Bilanz - Berechnung des Eigenkapitals
Auswertung der Bilanz 1
Auswertung der Bilanz 2
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Jahresabschluss: Auswertung der GuV
Zeitliche Rechnungsabgrenzung
Aktive und passive Rechnungsabgrenzung I
Aktive und passive Rechnungsabgrenzung II
Sonstige Forderungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Rückstellungen
Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
Zahlungsvorgänge
Grundlagen des Zahlungsverkehr
Zahlungsmöglichkeiten
Die bargeldlose Zahlung
Kartenzahlung
Zinsrechnung: Die einfache Zinsformel
Zinsrechnung: Zinsen für einige Monate oder Tage berechnen
Zahlungsmöglichkeiten im Online-Handel
Maßnahmen aus dem Kauf- und Zahlungsverhalten ableiten
Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 1
Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 2
Mahnverfahren
Verjährung bei Kaufverträgen: Verjährungsfrist
Verjährung bei Kaufverträgen: Hemmung und Neubeginn
Finanzierungserfolg durch Skontoausnutzung
Skonto: Überblick
Skonto: Lohnt sich ein Kontokorrentkredit?
Skonto: Effektiver Jahreszinssatz
Kreditarten und Risikoabsicherung
Grundlagen des Kapitalbedarfs
Finanzierungsarten
Leasing
Kreditarten
Kreditsicherung
Abzahlen eines Kredites
Eigentumsvorbehalt
Ergebnisrechnung / Abgrenzungsrechnung
Kosten- und Leistungsrechnung
Betriebsergebnis, neutrales Ergebnis und Gesamtergebnis
Ergebnistabelle
Abgrenzungsrechnung in der Ergebnistabelle
Externes und internes Rechnungswesen
Erträge und Leistungen
Neutrale Erträge
Aufwendungen und Kosten
Kalkulatorische Kosten
Neutrale Aufwendungen
Einnahmen und Ausgaben
Ergebnisauswirkungen
Kostenarten
Kostenarten
Gesetz der Massenproduktion (Fixkostendegression)
Betriebsabrechnungsbogen (BAB)
Einstufiger Betriebsabrechnungsbogen (BAB)
Handlungskostensatz
Deckungsbeitragsrechnung
Deckungsbeitragsrechnung 1: Der Stückdeckungsbeitrag
Deckungsbeitragsrechnung 2: Der Gesamtdeckungsbeitrag
Kennzahlen
Rentabilität
Umsatzrentabilität
Eigenkapitalrentabilität
Gesamtkapitalrentabilität
Produktivität
Rentabilitätskennzahlen: Mitarbeiterproduktivität
Rentabilitätskennzahlen: Umsatz pro Kunde
Flächenrentabilität
Liquidität 1., 2. und 3. Grades
Cashflow
Statistiken
Absatz- und Umsatzstatistik
Personalstatistik
Kundenstatistik
Projektarbeit
Merkmale eines Projekts
Projektphasen
Projekt: Zielformulierung (SMART)
Projektstrukturplan / Projektablaufplan (Gantt-Diagramm) und Vorgangsliste
Projektideen: Brainstorming und Mind-Mapping
Projekterfolg (Magisches Dreieck)
Projektbewertung (Projekt-Scorecard)
Projektabschluss
Transportmittel und logistische Dienstleistungen
Möglichkeiten der Güterbeförderung
Verkehrsmittel
Warenbeschaffung
Bedarfsermittlung: ABC-Analyse
Bedarfsermittlung: ABC-Analyse (Beispiel)
ABC-Analyse durchführen
Vertragsverhandlungen und Vertragsbedingungen
Lieferbedingungen und Incoterms 1
Lieferbedingungen und Incoterms 2
Währungsrechnen
Vertragserfüllung überwachen
Terminüberwachung
Lieferverzug (Nicht-Rechtzeitig-Lieferung)
Rechnungsprüfung
Schlechtleistung
Mahnverfahren
Wareneingang
Wareneingang
Praxisbeispiel Wareneingangskontrolle
Wareneingang: Rechtliche Vorschriften
Mängelarten
Rechte bei Mängeln
Warenlagerung
Aufgaben der Lagerhaltung
Lagergrundsätze
Warenpflege und Warenkontrolle
Technische Hilfsmittel im Lager
Statische und dynamische Regallagerung
Festplatzsystem und Freiplatzsystem
FIFO-Verfahren
LIFO-Verfahren
Sicherheit im Lager
Zusammenarbeit zwischen Einkauf, Verkauf und Lager
Darstellung und Auswertung von Lagerstatistiken
Warenausgang
Überblick Kommissioniermethoden
Auftragsorientierte serielle Kommissionierung
Auftragsorientierte parallele Kommissionierung
Serienorientierte parallele Kommissionierung
Die beleghafte Kommissionierung
Die beleglose Kommissionierung
Vorteile und Nachteile der beleglosen Kommissionierung
Lagerbestandsgrößen
Mindestbestand
Meldebestand
Meldebestand berechnen
Höchstbestand
Höchstbestand berechnen
Lagerkennzahlen
Durchschnittlicher Lagerbestand
Durchschnittlichen Lagerbestand berechnen
Umschlagshäufigkeit
Durchschnittliche Lagerdauer
Lagerzinssatz
Lagerzinsen
Maßnahmen zur Verbesserung der Lagerkennzahlen
Eigenlagerung oder Fremdlagerung?
Ursachen und Auswirkungen von Lagerkosten
Inventur
Grundlagen der Inventur
Inventurverfahren
Vorbereitung einer Inventur
Durchführung einer Inventur
Inventurdifferenzen
Berechnung von Inventurdifferenzen
Warenwirtschaftssystem
Ziele der Warenwirtschaft
Aufgaben der Warenwirtschaft
Was ist das Warenwirtschaftssystem?
Aufgaben des Warenwirtschaftssystems
Ziele des Warenwirtschaftssystems
Erfassung von Daten im Warenwirtschaftssystem
Fehler bei der Erfassung von Daten
Änderung von Daten im Warenwirtschaftssystem
Marktforschung
Marktforschung
Konkurrenzbeobachtung
Marketing-Mix
Marketinginstrumente
Produktpolitik
Sortimentspolitik
Preispolitik
Kommunikationspolitik
Distributionspolitik
Werbung, PR und Verkaufsförderung
Aufgaben und Ziele von Werbung
Grundsätze der Werbung
Arten der Werbung
Zielgruppen von Werbung
Werbemittel und Werbeträger
Werbeaktionen und Events
Werbeplan
Werbeagenturen
Werbebudget
Werbeerfolgskontrolle
Wettbewerbsrecht: Das UWG
Public Relations und Sales Promotion
Verkaufsförderung
Kundenorientierung
Instrumente der Kundenbindung
Umgang mit Beschwerden und Reklamationen
Kundenkarte
Serviceleistungen
Kundenpflege und Customer-Relationship-Management (CRM)
Betriebliche Vertriebskanäle
Direkte Absatzwege
Indirekte Absatzwege
Franchising als Gründungskonzept
Franchising: Vor- und Nachteile
Beispielrechnung Reisender vs Handelsvertreter
Beratungs- und Verkaufsgespräche
Anforderungen des Kunden an das Verkaufspersonal
Phasen des Verkaufsgespräches
Gesprächstechniken für das Verkaufsgespräch
Fragetechniken zur Bedarfsermittlung
Kaufmotive
Kundentypen
Grundsätze der Warenvorlage
Verkaufsargumente
Preisnennung mit der Sandwich-Methode
Verhalten bei Kundeneinwänden
Ergänzungsartikel und Zusatzartikel
Abschluss des Verkaufsgespräches
Grundlagen des Kaufvertragsrechts
Rechtsfähigkeit
Geschäftsfähigkeit
Besitz und Eigentum
Willenserklärungen und Rechtsgeschäfte
Wirksamkeit von Willenserklärungen
Abgabe von Willenserklärungen
Arten von Rechtsgeschäften
Formvorschriften für Rechtsgeschäfte
Nichtigkeit von Rechtsgeschäften
Anfechtung von Willenserklärungen
Anfechtungsgründe
Vertragsarten
Kaufvertrag
Mietvertrag
Leasingvertrag
Pachtvertrag
Dienst- und Werkvertrag
Kaufverträge abschließen
Vertragsfreiheit
Merkmale von Kaufverträgen 1
Merkmale von Kaufverträgen 2
Inhalt eines Kaufvertrages
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zustandekommen eines Kaufvertrages
Erfüllung und Störung von Kaufverträgen
Verpflichtungsgeschäft und Erfüllungsgeschäft
Eigentumsvorbehalt
Schlechtleistung
Lieferverzug (Nicht-Rechtzeitig-Lieferung)
Annahmeverzug (Nicht-Rechtzeitig-Annahme)
Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 1
Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 2
Mahnverfahren
Verjährung bei Kaufverträgen: Verjährungsfrist
Verjährung bei Kaufverträgen: Hemmung und Neubeginn
Besonderheiten von Auslandsgeschäften
Lieferbedingungen und Incoterms 1
Lieferbedingungen und Incoterms 2
Beschwerde, Reklamation und Umtausch
Umgang mit Beschwerden und Reklamationen
Wann ist eine Ware mangelhaft?
Wann ist eine Reklamation berechtigt?
Welche Rechte hat ein Kunde bei mangelhafter Ware?
Umtausch und Kulanz
Garantie
Grundlagen der Kalkulation
Das Kalkulationsschema
Welche Begriffe sind in der Kalkulation wichtig? Teil 1
Welche Begriffe sind in der Kalkulation wichtig? Teil 2
Rechnen mit vermehrtem Grundwert in Kalkulationen
Richtiges Runden in Kalkulationsaufgaben
Die Vorwärtskalkulation
Vorwärtskalkulation: Überblick
Vorwärtskalkulation: Die Bezugskalkulation
Vorwärtskalkulation: Die Verkaufskalkulation
Prüfungsaufgabe: Bezugskalkulation
Die Rückwärtskalkulation
Rückwärtskalkulation: Überblick
Rückwärtskalkulation: Beispielaufgabe
Verkürzte Kalkulationsverfahren
Der Kalkulationszuschlag
Der Kalkulationsfaktor
Die Handelsspanne
Prüfungsaufgabe: Der Kalkulationsfaktor
Prüfungsaufgabe: Der Kalkulationszuschlag
Preisbildung
Preisbildung
Preisuntergrenzen in der Preisverhandlung
Preisnachlässe - Rabatte, Preisreduzierung, Couponing
Break-Even-Point
Preisgestaltung
Kriterien für die Preisgestaltung
Kostenorientierte, nachfrageorientierte und konkurrenzorientierte Preisgestaltung
Preisänderungen: Gründe und Folgen
Preisreduzierungen (in Euro) berechnen
Preisreduzierungen (in Prozent) berechnen
Preisauszeichnung und Preisangabenverordnung
Distributionspolitik
Distributionspolitik
Möglichkeiten der Güterbeförderung
Verkehrsmittel
Kaufmännisches Runden
Kaufmännisches Runden
Dreisatz
Gerader und ungerader Dreisatz
Dreisatzaufgaben Schritt für Schritt lösen
Dreisatzaufgaben erkennen und lösen
Durchschnittsrechnen
Einfacher Durchschnitt
Gewogener / gewichteter Durchschnitt
Durchschnitt berechnen: Typische Aufgaben
Verteilungsrechnen
Grundlagen der Verteilungsrechnung
Bezugskosten: Verteilung von Gewichts- und Wertspesen
Prozentrechnen
Grundlagen der Prozentrechnung
Formeln: Prozentwert, Prozentsatz und Grundwert
Vermehrter und verminderter Grundwert
Tabellen und Diagramme
Tabellen: Wichtige Grundlagen
Tabellen: Typische Aufgaben
Rechnen mit Tabellen
Diagramme: Wichtige Grundlagen
Diagramme: Typische Aufgaben
Bedürfnisse und Güter
Bedarf, Existenz-, Kultur-, Luxusbedürfnisse
Individual- und Kollektivbedürfnisse
Freie Güter
Knappe Güter: Rechte und Dienstleistungen
Knappe Güter: Produktionsgüter & Konsumgüter
Prinzipien wirtschaftlichen Handelns
Wirtschaftlichkeitsprinzip
Erwerbswirtschaftliches und gemeinwirtschaftliches Prinzip
Ziele von Unternehmen
Markt und Preis
Wirtschaftsstufen (Sektoren)
Einfacher Wirtschaftskreislauf
Der Markt und seine Funktionen
Was beeinflusst das Angebot?
Was beeinflusst die Nachfrage?
Marktpreisbildung
Der "vollkommene Markt"
Marktpreisfunktionen
Marktformen: Monopol, Oligopol, Polypol
Konjunktur und wirtschaftliche Entwicklung
Konjunkturphasen
Indikatoren für Konjunkturphasen
Wirtschaftspolitische Entscheidungen
Ziele der Wirtschaftspolitik: Preisniveaustabilität
Ziele der Wirtschaftspolitik: Außenwirtschaftliches Gleichgewicht
Ziele der Wirtschaftspolitik: Hoher Beschäftigungsstand
Ziele der Wirtschaftspolitik: Stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum
Weitere Ziele der Wirtschaftspolitik
Ziele und Kennzahlen von Unternehmen
Ziele von Unternehmen
Zielbeziehungen und Zielkonflikte
Formal- und Sachziele
Gewinnerzielung
Wirtschaftlichkeit
Rentabilität
Produktivität
Aufbau und Aufgaben von Unternehmen
Aufbauorganisation
Leitungssysteme und ihre Organigramme
Ablauforganisation
Beziehungen zu Behörden, Organisationen und Gewerkschaften
Ämter und Behörden
Berufsständische Organisationen
Gewerkschaften
Arbeitgeberverbände
Rechtsformen von Unternehmen
Überblick Rechtsformen
Merkmale von Rechtsformen
Einzelunternehmung / Einzelunternehmen
Offene Handelsgesellschaft (OHG)
Kommanditgesellschaft
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
GmbH & Co. KG
Aktiengesellschaft (AG)
Gewinnverteilung einer Personengesellschaft berechnen
Gewinnverteilung einer GmbH berechnen
Wann passt welche Rechtsform?
Genossenschaft
Handelsrechtliche Grundlagen
Natürliche und juristische Personen
Handelsregister: Inhalt und Aufbau
Handelsregister: Zweck und Eintragungen
Kaufmannseigenschaft: Istkaufmann, Kannkaufmann, Formkaufmann
Firma und Firmenarten
Firmengrundsätze
Geschäftsführung und Vertretung
Ausbildungsvertrag, Arbeitsvertrag und Vergütung
Der Berufsausbildungsvertrag: Die wichtigsten Inhalte
Der Berufsausbildungsvertrag: Pflichten für Betriebe und Auszubildende
Ausbildungsvergütung
Arbeitsvertrag (Teil 1): Wesentliche Inhalte
Arbeitsvertrag (Teil 2): Pflichten der Vertragspartner
Arbeitsvertrag (Teil 3): Beendigung eines Arbeitsverhältnisses
Lohn und Gehalt: Grundlagen
Lohn und Gehalt: Brutto und Netto
Grundlagen des Arbeitsrechts
Berufsbildungsgesetz
Ausbildungsordnung
Jugendarbeitsschutzgesetz
Kündigungsschutzgesetz
Der besondere Kündigungsschutz
Mutterschutzgesetz
Elternzeit
Elterngeld
Arbeitszeitgesetz
Betriebsverfassungsgesetz
Betriebsvereinbarung
Das Personalwesen
Arbeitsstelle und Stellenbeschreibung
Stellenausschreibung
Belehrung, Ermahnung und Abmahnung
Personalplanung
Personalbeschaffung
Personaleinsatzplanung
Personalentwicklung
Tarifrecht und Arbeitskampf
Gewerkschaften
Arbeitgeberverbände
Zustandekommen von Tarifverträgen
Bedeutung von Tarifverträgen
Arten von Tarifverträgen
Mittel tarifrechtlicher Auseinandersetzungen
Mitwirkung und Mitbestimmung der Beschäftigten
Betriebsrat
Jugend- und Auszubildendenvertretung
Betriebsversammlung
Sicherheit und Gesundheitsschutz
Arbeitsschutzvorschriften
Unfallverhütungsvorschriften
Symbole der Unfallverhütung (Sicherheitszeichen)
Verhalten bei Arbeitsunfällen
Brandschutz
Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung Teil 1
Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung Teil 2
Umweltschutz
Grundlagen des Umweltschutzes
Verpackungsgesetz
Abfallhierarchie (Kreislaufwirtschaftsgesetz)
Umwelt- und Recyclingzeichen
Energieeinsparung im Unternehmen
Ressourcenschonung
Infos und Tipps für die mündliche Prüfung
Der Tag vor der Prüfung
Ablauf am Prüfungstag
Tipps für die Aufgabenbearbeitung
Tipps für Dein Auftreten im Prüfungsgespräch
Prüfungsangst und Blackout
Was passiert bei Nicht-Erscheinen?
Bestanden oder durchgefallen - Was passiert dann?
Lasse dich jetzt persönlich beraten:
Rufe uns an unter 04131 60 66 233 oder: